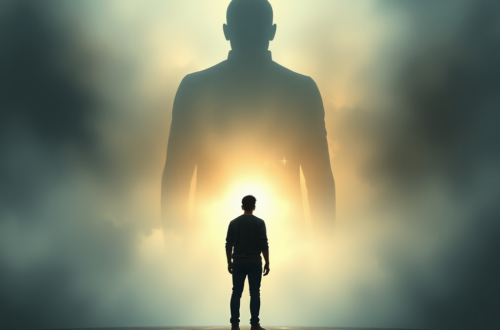Die erschöpfte Republik
Warum unsere Gesellschaft psychisch am Limit ist
Psychische Erschöpfung ist kein Randphänomen mehr. Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass sich dieser Zustand in der Mitte der Gesellschaft etabliert hat. Jede dritte Person unter 25 leidet an psychischen Problemen, besonders stark betroffen sind junge Frauen. Hinter diesen Zahlen stehen stille Krisen, verlorene Lebensfreude und ein wachsendes Gefühl der Sinnlosigkeit. Was läuft schief in einer Gesellschaft, die äußerlich so gut vernetzt und informiert ist wie nie zuvor?
Ein System am Anschlag
Schon vor der Corona-Pandemie war der Druck hoch: Arbeitsverdichtung, ständige Erreichbarkeit, Konkurrenzdruck, Leistungsdenken. Die Pandemie hat diesen Druck nicht erzeugt, aber sie hat ihn wie ein Brennglas verstärkt. Besonders auffällig ist die Zunahme psychischer Erkrankungen bei jungen Menschen. Zwischen 2017 und 2022 stieg der Anteil psychisch erkrankter junger Frauen von 19 % auf 29 %, bei jungen Männern von 9,6 % auf 16,4 %.
Von der Überforderung zur Gratifikationskrise
Viele Menschen arbeiten immer mehr, opfern ihre Freizeit, ihre Regenerationsphasen – doch Anerkennung, Wertschätzung und ein Gefühl von Sinn bleiben oft aus. Der Soziologe Johannes Siegrist spricht in diesem Zusammenhang von einer „Gratifikationskrise“: Die Belohnung steht in keinem angemessenen Verhältnis mehr zum Einsatz. Auch Paul Watzlawick wies darauf hin, dass ein „Mehr desselben“ keine neue Lösung bringt. Wer sich erschöpft fühlt, wird durch noch mehr Leistung nicht gesünder oder zufriedener.
Digitaler Druck und der Verlust echter Berührung
Soziale Medien suggerieren ständig: Da draußen gibt es Menschen, die produktiver, schöner, glücklicher sind. Gerade für junge Menschen entsteht ein ständiger Vergleichsdruck, der das Selbstwertgefühl untergräbt. Doch was auf Instagram & Co. sichtbar ist, bleibt ein Scheinbild. In Wahrheit blickt uns niemand durch ein Smartphone an. Es fehlt an echter Begegnung, an Resonanz, an Berührung.
Berührung lässt sich nicht simulieren. Schon im Mittelalter verstand man unter „Virtualität“ das Erscheinen eines Bildes, wo kein Bild ist – etwa durch Spiegeltricks im Theater. Auch heute erleben wir Bilder, doch die Berührung, die echte Verbindung, bleibt aus. Kinder, die keine Berührung erfahren, können daran seelisch zugrunde gehen. Wie steht es da um eine Gesellschaft, die sich zunehmend in den digitalen Raum zurückzieht?
Was das Systemische Coaching beitragen kann
Systemisches Coaching betrachtet den Menschen nicht isoliert, sondern eingebettet in seine sozialen und beruflichen Kontexte. Es fragt: Was brauchst du, um wieder in deine Kraft zu kommen? Wo kannst du Einfluss nehmen, statt dich ohnmächtig zu fühlen? Und was darfst du loslassen, was dich erschöpft?
Der systemische Blick hilft, Zusammenhänge zu erkennen und neue Perspektiven zu entwickeln. Wer sich selbst ändert, verändert auch das System um sich herum. Selbst kleine Schritte können eine große Wirkung haben – und dabei helfen, psychische Gesundheit nicht nur individuell, sondern gesellschaftlich zu stärken.
Fazit
Wir leben in einer erschöpften Republik. Doch das bedeutet nicht, dass wir uns damit abfinden müssen. Es bedeutet vielmehr, dass es an der Zeit ist, genau hinzusehen. Nicht auf das vermeintlich perfekte Leben anderer, sondern auf das eigene: Was macht mich lebendig? Was lässt mich regenerieren? Und wie kann ich für mich sorgen, ohne das System zu bedienen, das mich krank macht?
Coaching ist dabei kein Luxus, sondern eine Investition in seelische Gesundheit und echte Wirksamkeit. Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Menschen das Gefühl haben, den Boden unter den Füßen zu verlieren, kann Coaching helfen, diesen Boden neu zu finden – und vielleicht sogar neu zu gestalten.
Interessiert? Laß‘ uns ein ein erstes unverbindliches Gespräch über Coaching führen.
Entdecke mehr von Stig Pfau
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.