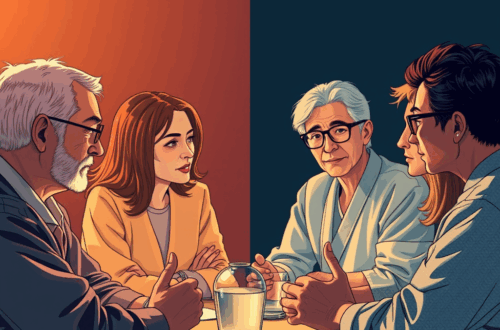Gefahren isolierter Betrachtung
Warum das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile
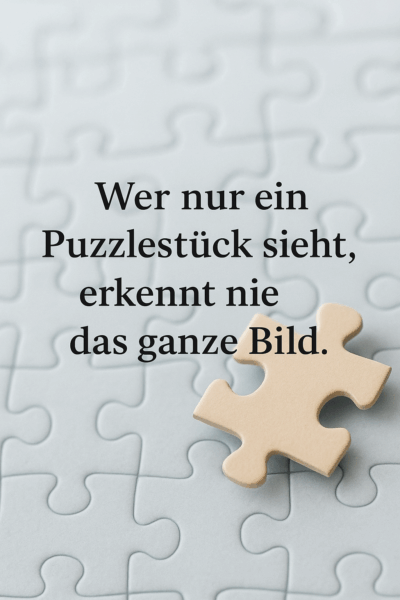
Wir Menschen haben eine Schwäche: Wir lieben es, Dinge einzeln und klar abgetrennt zu betrachten. Ein Symptom, eine Zahl, ein Prozess – alles wirkt greifbar, wenn man es isoliert. Doch diese scheinbare Klarheit ist trügerisch. Sie blendet die Wechselwirkungen und das große Ganze aus. Wer nur auf das einzelne Puzzlestück starrt, wird nie das Bild erkennen.
Zwei Beispiele – eines aus der Medizin, eines aus dem Projektmanagement – zeigen, wie gefährlich eine solche Engführung sein kann.
Beispiel aus der Medizin: Bluthochdruck als Zahl statt als Mensch
Ein Patient kommt in die Praxis. Sein Blutdruck ist zu hoch. Die Lösung scheint klar: ein Medikament, das den Wert senkt. Auftrag erfüllt – die Zahl passt wieder.
Doch was wird hier übersehen?
- Der Patient lebt in einer lauten Innenstadt. Dauerhafter Verkehrslärm raubt ihm den Schlaf.
- Er arbeitet in einem stressigen Job, steht permanent unter Druck, findet kaum Zeit für Bewegung oder gesunde Ernährung.
- Psychische Belastungen – vielleicht Einsamkeit oder Ängste – verstärken die Anspannung zusätzlich.
Das Medikament senkt zwar den Blutdruck, aber es verändert nichts an den Ursachen. Der Mensch wird auf eine Funktion reduziert, auf einen einzelnen Wert, während die Wechselwirkungen von Lebensumfeld, Psyche und Verhalten ausgeblendet werden. Die Folge: ein Pflaster auf einer offenen Wunde. Kurzfristig Linderung, langfristig eine verpasste Chance, den Menschen wirklich zu verstehen und nachhaltig zu helfen.
Dieses Denken in isolierten Kategorien ist bequem, weil es klare Lösungen bietet. Aber es bleibt an der Oberfläche.
Mehr zu körperlichen Beschwerden findest du hier.
Beispiel aus dem Projektmanagement: Wenn jeder nur seinen Garten pflegt
Ein ähnliches Muster begegnet uns im Projektmanagement. In einem komplexen Projekt lief zunächst alles glänzend:
- Die Abteilungen hielten ihre Termine ein.
- Budgets wurden eingehalten.
- Arbeitspakete waren sauber dokumentiert.
Jede Einheit konnte stolz auf ihre Kennzahlen verweisen. Doch das große Ganze? Es funktionierte nicht.
- Schnittstellen zwischen den Abteilungen waren unklar.
- Informationen versandeten, weil jeder nur auf seinen Bereich fokussiert war.
- Entscheidungen wurden blockiert, weil keiner das Ganze im Blick hatte.
Formal war das Projekt ein Erfolg – jedes Puzzlestück glänzte. In der Realität aber scheiterte es, weil das Zusammenspiel fehlte. Es war, als ob man eine perfekt gestimmte Geige, ein makelloses Cello und ein meisterhaftes Klavier zusammensetzt – aber niemand dirigiert, niemand achtet auf das gemeinsame Stück. Am Ende entsteht keine Musik, sondern Kakophonie.
Die Parallele: Reduktion statt Vernetzung
Ob in der Medizin oder im Management – das Muster ist dasselbe:
- Der Blick verengt sich auf das Einzelne.
- Erfolge werden an isolierten Kennzahlen festgemacht.
- Komplexität wird ausgeblendet, weil sie unbequem ist.
Doch das Leben – und jedes Projekt – ist komplex. Wechselwirkungen sind unvermeidbar. Wer sie ignoriert, riskiert, dass kurzfristige „Erfolge“ langfristig in Sackgassen führen.
Systemischer Blick: Vom Einzelnen ins Ganze
Hier kommt der systemische Ansatz ins Spiel. Er fragt nicht nur nach dem Symptom, sondern nach dem Kontext:
- Was bedeutet dieser hohe Blutdruck in der Lebenssituation des Patienten?
- Wie beeinflusst der Stress bei der Arbeit seine Gesundheit?
- Welche Rolle spielen Schlaf, Ernährung, soziale Beziehungen?
Und im Projektmanagement:
- Wie greifen die Teilprozesse ineinander?
- Was passiert an den Schnittstellen?
- Wie wirken Kultur, Kommunikation und Führung auf die harten Zahlen?
Der systemische Blick erkennt, dass die Qualität des Ganzen nicht in der Summe der Teile liegt, sondern in den Beziehungen zwischen ihnen.
Ein unbequemes Fazit
Die isolierte Betrachtung ist verführerisch. Sie liefert schnelle Antworten, klare Verantwortlichkeiten, messbare Kennzahlen. Doch sie ist auch gefährlich, weil sie die Wirklichkeit verkürzt.
Die bessere – und unbequeme – Haltung ist es, Fragen zu stellen:
- „Was übersehe ich, wenn ich nur auf diese Zahl schaue?“
- „Welche Wechselwirkungen spielen hier eine Rolle?“
- „Wie verändert sich das Bild, wenn ich den Kontext einbeziehe?“
Im Coaching, in der Medizin, im Projektmanagement – überall dort, wo Menschen mit Menschen arbeiten, ist dieser Blick entscheidend. Nur so lassen sich nachhaltige Lösungen finden, die nicht bloß Symptome bekämpfen, sondern das Ganze im Blick behalten.
Systemische Forensik ist eine effiziente Methode um das ganze Puzzle zu erkennen. Hier findest du einen Beitrag dazu.
Ausblick: Wo schaust du zu eng?
Vielleicht ist das der Impuls, den du aus diesem Text mitnehmen kannst: Wo in deinem Alltag betrachtest du Dinge isoliert?
- Die eine Zahl im Reporting, die scheinbar alles sagt?
- Den einen Mitarbeiter, der „nicht funktioniert“, ohne das Teamgefüge zu hinterfragen?
- Deine eigene Gesundheit, gemessen an einem Laborwert, ohne den Lebensstil einzubeziehen?
Der systemische Blick fordert uns heraus – aber er schenkt uns auch die Möglichkeit, tiefer zu verstehen und nachhaltiger zu handeln.
Möchtest du über den Tellerrand hinausblicken oder blinde Flecken erkennen?
Ich lade dich ein, ein erstes unverbindliches Gespräch über dein Puzzle zu führen. Hier geht es zu meinen Kontaktdaten.
Entdecke mehr von Stig Pfau
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.