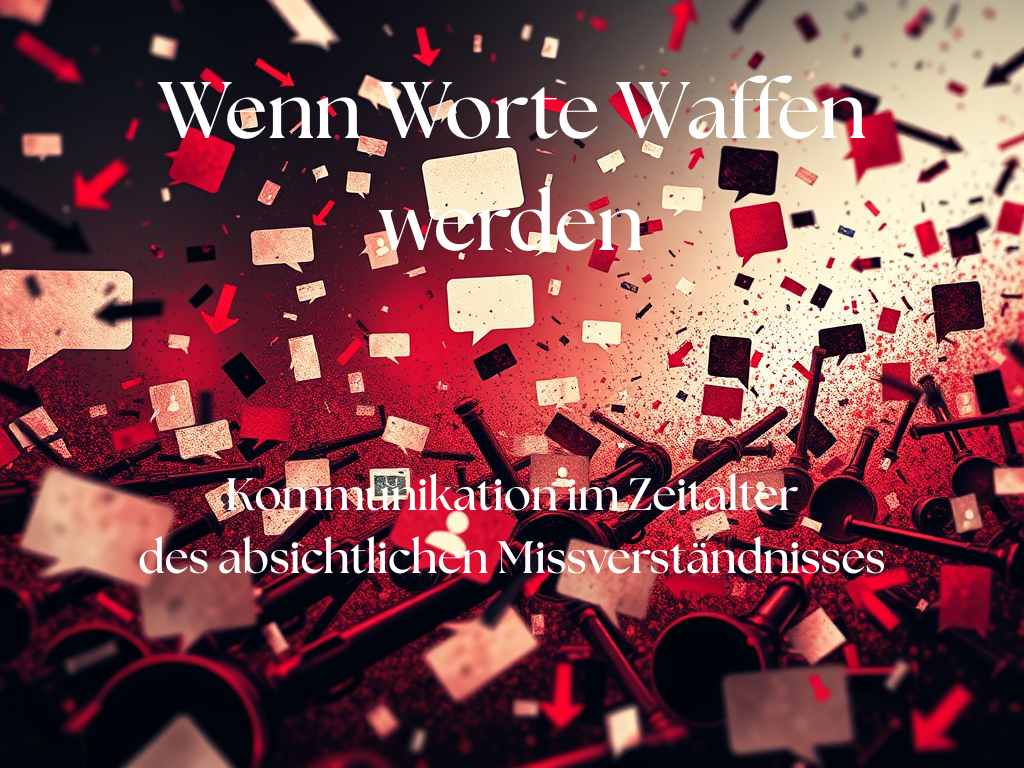
Wenn Worte Waffen werden
Kommunikation im Zeitalter des absichtlichen Missverständnisses
Es war einmal eine Zeit, da galten Worte als Brücken. Heute scheinen sie oft eher Stolperdrähte zu sein.
Ein falsches Wort, ein ungeschickter Halbsatz – und schon fliegt der Deckel vom digitalen Fass.
Was früher als Missverständnis galt, wird heute gern zur Schlagzeile gemacht. Oder besser: zur Schlagwaffe.
Das Spiel mit der Empörung
Manchmal frage ich mich, ob es wirklich noch um Inhalte geht.
Oder ob Kommunikation – besonders in den sozialen Medien – längst ein strategisches Spiel geworden ist:
Wer reagiert schneller? Wer empört sich lauter? Wer schafft es, aus einem Nebensatz eine moralische Empörung zu züchten?
Die jüngste Diskussion um die „Stadtbild“-Aussage von Friedrich Merz ist dafür ein Paradebeispiel.
Ein Satz, mehrdeutig formuliert, wird zum Fanal.
Innerhalb von Stunden stürzen sich Kommentatoren, Parteien und Medien auf die Interpretation.
Was meinte er? Wie konnte er nur?
Was bleibt, ist ein Schlachtfeld aus Fragmenten, Schlagworten und Screenshots.
Doch das eigentlich Erschreckende daran ist nicht, dass solche Eskalationen passieren –
sondern wie sehr wir sie brauchen.
Empörung ist zur Währung geworden.
Jede Plattform belohnt Reaktion: Herzchen, Flammen, Daumen runter.
Je stärker die Emotion, desto höher der Algorithmus.
Und so entstehen aus Alltäglichkeiten digitale Nahkämpfe:
„Ich mag es, Krawatte zu tragen.“ – Was? Spießer! Konservativ! Toxic Masculinity!
„Ich arbeite gern allein.“ – Aha, teamunfähig!
„Ich brauche Ruhe.“ – Oh, Burn-out-Kandidat!
Es ist, als ob wir kollektiv verlernt hätten, nachzufragen, bevor wir verurteilen.
Missverständnisse mit Methode
Missverständnisse sind eigentlich ein natürlicher Bestandteil menschlicher Kommunikation.
In gesunden Beziehungen klärt man sie – in sozialen Netzwerken kultiviert man sie.
Was früher als „Fehlinterpretation“ galt, ist heute Teil der Strategie.
Beiträge werden bewusst mehrdeutig verfasst, um Reaktionen zu provozieren.
Andere wiederum werden absichtlich missverstanden, um einen moralischen Vorteil zu erzeugen.
Ein perfides Wechselspiel: Einer legt die Falle, der andere tritt hinein – und beide profitieren.
Der Kommunikationswissenschaftler nennt das „strategische Ambiguität“.
Ich nenne es: das Spiel mit der Lupe.
Ein Coach (oder Detektiv) schaut nicht nur auf die Worte, sondern auf das, was nicht gesagt wird.
Wer profitiert davon, wenn ein Satz skandalisiert wird?
Wer ruft „Empörung!“ – und warum gerade jetzt?
Vom Dialog zur Duellkultur
Was früher Gespräch hieß, nennt man heute Kommentarspalte.
Dort trifft man sich nicht, um zu verstehen, sondern um zu siegen.
Sprache ist zum Kampfsport geworden.
Und wer sich nicht eindeutig positioniert, gilt schnell als feige oder uninformiert.
Differenzierung wird mit Schwäche verwechselt, Nachdenklichkeit mit mangelnder Haltung.
Das Problem: Wir verlieren die Fähigkeit zur Zwischentöne-Kompetenz.
Also die Kunst, zu erkennen, dass jemand nicht gegen uns spricht –
sondern vielleicht nur eine andere Perspektive hat.
Und genau hier wird Coaching zur Detektivarbeit:
Im Coachingraum lernen Menschen wieder, hinter die Worte zu hören.
Nicht nur, was gesagt wird – sondern wie und warum.
Wo die Emotion herkommt. Welche Geschichte sie nährt.
Denn wer das versteht, kann deeskalieren, bevor der Shitstorm beginnt.
Warum Führungskräfte besonders gefährdet sind
Führungskräfte – oder Menschen mit öffentlicher Stimme – stehen in diesem Klima besonders unter Druck.
Ein Satz in einem Interview, ein falsch platzierter Post, eine unbedachte Mail –
und schon läuft die digitale Lawine.
Der Wunsch, „authentisch“ zu kommunizieren, kollidiert mit der Angst, missverstanden zu werden.
Viele ziehen sich zurück, sprechen nur noch in sicheren Floskeln.
Andere wiederum nutzen bewusst die Polarisierung, um Sichtbarkeit zu erzeugen.
Beides führt zu einer toxischen Kultur: Schweigen oder Schreien.
Coaching kann hier zum Resonanzraum werden.
Ein Ort, an dem Sprache wieder klangvoll, differenziert, menschlich werden darf.
Ein Ort, an dem die Frage erlaubt ist:
„Wie meine ich das wirklich?“ –
und: „Wie könnte es bei anderen ankommen?“
Ein Plädoyer für die Rückkehr des Zuhörens
Ich glaube, wir stehen an einem Punkt, an dem Kommunikation neu gelernt werden muss.
Nicht als Technik, sondern als Haltung.
Zuhören statt urteilen.
Nachfragen statt angreifen.
Verstehen wollen statt recht behalten.
Das mag altmodisch klingen – vielleicht sogar „spießig“.
Aber in einer Welt, in der jedes Wort zum Brandbeschleuniger werden kann,
ist Achtsamkeit kein Luxus mehr, sondern Notwendigkeit.
Wer sich die Mühe macht, einen Satz erst zu verstehen, bevor er ihn teilt,
der trägt zur Heilung eines kollektiven Kommunikationsfiebers bei.
Fazit: Der Detektiv der Worte
Ich sehe Kommunikation heute wie ein Tatort.
Ein Raum voller Spuren, Motive, Emotionen.
Die Aufgabe ist nicht, sofort den Täter zu benennen –
sondern zu verstehen, was hier wirklich passiert ist.
Denn jedes Missverständnis erzählt eine Geschichte:
von Angst, von Zugehörigkeit, von Identität.
Und jedes laute Wort im Netz ist vielleicht nur der Schrei eines Menschen,
der sich selbst nicht gehört fühlt.
Vielleicht ist das die eigentliche Aufgabe unserer Zeit:
Nicht lauter zu sprechen, sondern klarer.
Und nicht auf die Krawatte zu schauen –
sondern auf den Menschen, der sie trägt.
Wie siehst du das? Wird in Social Media absichtlich missverstanden?
Teile deine Gedanken in den Kommentaren – oder lass uns über das reden, was zwischen den Zeilen steht. Hier geht es zu meinen Kontaktdaten.
Entdecke mehr von Stig Pfau
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.




