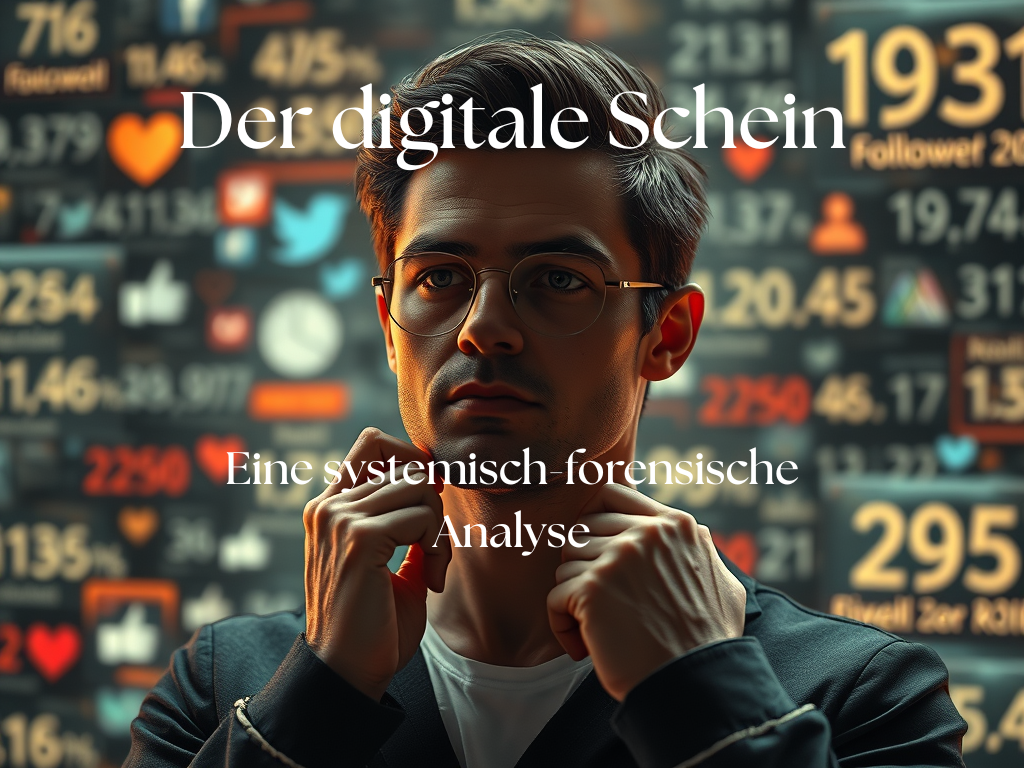
Der digitale Schein
Systemische Forensik: Die Anatomie des digitalen Scheins
Es beginnt meistens harmlos.
Ein neues Profil. Ein paar Posts. Ein Konto, das noch nach „Neuanfang“ riecht. Und die ersten Menschen reagieren. Likes 👍 – Herzchen ❤️ – Kommentare 💬. Und dann dieser Gedanke: „Wenn ich nur ein bisschen mehr Sichtbarkeit hätte, würden mich die Leute endlich ernst nehmen.“
Ein Klick später ist man Teil einer stillen, aber wachsenden Bewegung: Menschen, die Follower kaufen, Likes mieten. Aus einer Unterhaltung auf LinkedIn habe ich sogar erfahren, dass Bewerbungen werden Lebensläufe aufpoliert und selbst Gehaltsnachweise gefälscht – um besser dazustehen, um gesehen zu werden, um mithalten zu können. Denn es gibt auf den Social Media Seiten so viele, so erfolgreiche Personen. Posts von Luxusautos, prächtigen Häusern – ein Leben wie aus Hollywood.
Und es ist einfach – und günstig.
Mir werden regelmäßig Angebote gemacht. 1000 Follower kosten gerade mal 29$.
Aber was läuft hier wirklich ab?
Tatort: Die Bühne der Selbstinszenierung
Wir leben in einer Gesellschaft, die Zahlen liebt – Empirie.
Follower, Reichweite, Einkommen, Schritte pro Tag, Kalorien – alles wird gemessen, bewertet, verglichen.
Zahlen sind die neue Währung der Anerkennung. Und wer mehr davon hat, gewinnt – oder sieht zumindest so aus.
Diese Logik macht aus Plattformen soziale Marktplätze. Und auf diesen Marktplätzen zählt nicht, wer du bist, sondern wie du wirkst.
In dieser Gleichung wird Echtheit schnell zum Luxus, den sich viele nicht mehr leisten.
Der Philosoph Søren Kierkegaard hat den Satz geprägt:
„Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit“
Das psychologische Motiv: Der Hunger nach Sichtbarkeit
Die meisten Menschen, die zu solchen Methoden greifen, tun das nicht aus Bosheit, sondern aus Mangel – Mangel an Resonanz. An Aufmerksamkeit. An Anerkennung.
Sie spüren: In dieser Welt wirst du nicht gesehen, wenn du nicht zuerst auffällst.
Der Algorithmus liebt das Lauteste, nicht das Wahrste. Und wer auf der digitalen Bühne bestehen will, lernt schnell, dass Authentizität zwar sympathisch ist – aber kaum Reichweite bringt.
Das ist der erste systemische Riss:
Ein System, das Ehrlichkeit fordert, aber Täuschung belohnt.
Das soziale Motiv: Der Druck der Vergleichbarkeit
Früher hast du dich mit deinem Nachbarn verglichen. Heute mit der ganzen Welt.
Wenn du auf LinkedIn liest, dass jemand mit 28 schon „Senior Consultant“ ist oder auf Instagram siehst, dass jemand mit 5.000 Followern „Coach“ ist, während du noch an deiner Position oder deinem Text feilst – dann entsteht Druck.
Leiser Druck, der nach innen arbeitet.
Und irgendwann sagt eine Stimme: „Mach es doch auch. Nur ein bisschen.“
So wird aus Anpassung Konformität. Aus Konformität Täuschung.
Und das System applaudiert. Denn sichtbar ist sichtbar – egal, ob echt oder nicht.
Das strukturelle Motiv: Der algorithmische Verstärker
Plattformen haben kein Interesse an deiner Wahrheit.
Sie haben Interesse an deinem Engagement.
Je mehr du klickst, kommentierst und vergleichst, desto mehr Daten generierst du.
Und je mehr „Erfolg“ du siehst – echt oder gefälscht –, desto stärker bleibst du im Spiel.
Der Algorithmus ist der stille Dealer des digitalen Narzissmus:
Er liefert kleine Dosen Anerkennung in Form von Likes, die gerade reichen, um dich wiederkommen zu lassen.
Ein systemischer Verstärker, der Täuschung nicht verhindert, sondern sie algorithmisch belohnt.
Das ökonomische Motiv: Erfolg als Ware
Gekaufte Follower sind kein Betrug im klassischen Sinne – sie sind ein Symptom einer Ökonomie, die Erfolg verkauft.
Sichtbarkeit ist Kapital.
Und wer sichtbar ist, bekommt Einladungen, Aufträge, Aufmerksamkeit.
In dieser Logik ist der Kauf von Followern ein Investment – eine Art Startkapital für das digitale Selbst.
Moralisch fragwürdig, ja.
Aber systemisch nachvollziehbar.
Die forensische Spur: Was das System verrät
Wenn wir diese Fälle systemisch lesen, sehen wir kein individuelles Fehlverhalten, sondern eine kollektive Schieflage:
- Eine Gesellschaft, die Authentizität verlangt, aber Performance belohnt.
- Plattformen, die Selbstdarstellung fördern, aber Selbstreflexion bestrafen.
- Menschen, die gesehen werden wollen, aber nicht wissen, wie sie ohne Maske sichtbar bleiben können.
Es ist ein Spiegel, der nicht mehr zwischen Sein und Schein unterscheidet.
Mehr über systemische Forensik findest Du hier.
Der Coaching-Blick: Zurück in die Echtheit
Was hilft?
Nicht moralische Empörung, sondern Bewusstsein.
Wer in diesem System bestehen will, braucht keine neue Strategie, sondern innere Klarheit.
Ein gesundes Verhältnis zur eigenen Bedeutung, zu echtem Erfolg, zu Authentizität.
Im Coaching würde ich fragen:
„Wem willst du eigentlich gefallen – und was zahlst du dafür?“
Die Antwort ist selten angenehm, aber sie führt zurück zum Wesentlichen:
zur eigenen Integrität.
Fazit: Täuschung ist kein individueller Fehler, sondern ein systemisches Symptom
Wir alle tragen Verantwortung – als Nutzer, Konsumenten, Führungskräfte, Coaches.
Solange wir Zahlen über Bedeutung stellen, werden Menschen sie manipulieren.
Solange Erfolg messbar bleibt, wird Echtheit zur Verhandlungsmasse.
Doch es gibt eine Gegenbewegung: Menschen, die den digitalen Lärm satt haben.
Die lieber weniger, aber echt sind.
Die wissen: Sichtbarkeit ist wertlos, wenn sie nicht von innen kommt.
Und vielleicht ist das die eigentliche Revolution:
Echtheit statt Algorithmus. Sein statt Schein.
Möchtest Du mehr über wahrhafte Sichtbarkeit erfahren?
Sprich mich an – hier geht es zu meinen Kontaktdaten.
Entdecke mehr von Stig Pfau
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.




