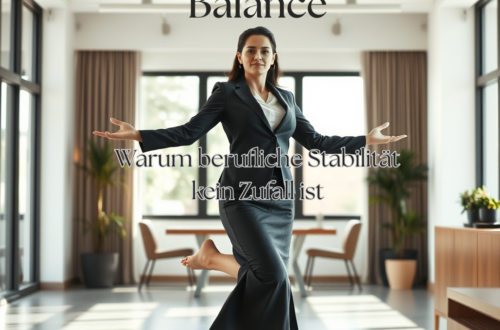Wandel zwischen den Fronten
Wie Coaching hilft, Veränderung im System zu gestalten
Veränderung ist selten das Problem. Der Widerstand dagegen schon.
Und oft trifft er nicht die, die ihn auslösen, sondern die, die ihn umsetzen sollen.
Viele Change-Verantwortliche, Teamleiter oder interne Projektbegleiter finden sich zwischen zwei Stühlen wieder:
Auf der einen Seite das Management mit klaren Zielen, Zahlen und Deadlines. Auf der anderen Seite Mitarbeitende, die zwischen Skepsis, Überforderung und offener Ablehnung schwanken.
Dazwischen steht man selbst – als Vermittler, Übersetzer, oft als Blitzableiter.
Wer einmal in dieser Rolle war, weiß, wie zermürbend das sein kann.
Und wie schnell man dabei selbst den Kontakt zu Klarheit und innerem Kompass verliert.
Wie man trotz Nebel (systemisch) navigieren kann findest du hier.
Wenn Veränderung zum Ermittlungsfall wird
Jede Organisation hat ihre verborgenen Regeln, unausgesprochenen Absprachen und verschlungenen Loyalitäten. – Sie zu erkennen, ist fast wie Detektivarbeit.
Warum werden Entscheidungen nicht umgesetzt, obwohl alle zustimmen?
Warum verharren Teams in endlosen Abstimmungen, statt ins Handeln zu kommen?
Warum reden alle vom Wandel – aber keiner verändert sich wirklich?
Der Organisationspsychologe Prof. Peter Kruse beschrieb dieses Phänomen mit entwaffnender Klarheit:
„Systeme reagieren auf Veränderung zunächst mit Selbststabilisierung.“
Mit anderen Worten: Komplexe Systeme wollen überleben – und sie tun das, indem sie das Bekannte verteidigen.
Kruse fasste dieses Prinzip in seinen „acht Regeln für den Stillstand“ zusammen: Man schafft scheinbare Einigkeit, diskutiert endlos, verteilt Verantwortung, produziert Zahlen, schafft neue Gremien, betont die Risiken, ruft nach mehr Information – und tut am Ende: nichts.
Diese Mechanismen sind nicht Ausdruck von Faulheit oder Ignoranz. Sie sind Selbstschutzreaktionen des Systems.
Und genau hier liegt der Schlüssel zur Veränderung: Nicht gegen den Widerstand kämpfen – sondern ihn verstehen.
Rund drei Viertel aller Change-Projekte scheitern – immer wieder, und das seit Jahrzehnten. Nicht, weil die Strategien schlecht wären oder die Zielbilder unklar. Sondern, weil der Faktor Mensch unterschätzt wird. Zwischen Management, das schnelle Ergebnisse fordert, und Mitarbeitenden, die Sicherheit suchen, entsteht ein Spannungsfeld, in dem Vertrauen oft als erstes verloren geht.
Genau hier setzt Coaching an. Es bietet einen neutralen und sicheren Raum. Spannungen dürfen hier sichtbar werden. Perspektiven finden wieder zueinander. Führungskräfte lernen, den Wandel nicht nur zu managen. Sie gestalten ihn bewusst. Wer Veränderungen begleitet, braucht kein weiteres Tool – sondern die Fähigkeit, Muster zu erkennen, Dynamiken zu verstehen und Vertrauen wieder aufzubauen.
Eine Geschichte aus dem Maschinenraum des Wandels
Vor einiger Zeit begleitete ich eine Teamleiterin in einem großen Konzern.
Sie war verantwortlich für ein Change-Projekt, das Prozesse digitalisieren und Entscheidungswege verkürzen sollte.
Das Management drängte auf Tempo, die Belegschaft auf Entlastung – und sie stand dazwischen.
„Ich habe das Gefühl, egal was ich tue, einer Seite tue ich immer weh“, sagte sie im Coaching.
„Wenn ich Druck mache, heißt es, ich wäre zu forsch. Wenn ich Verständnis zeige, bin ich zu weich.“
Wir begannen, gemeinsam zu ermitteln.
Nicht im Sinne von Schuldzuweisung, sondern im Sinne eines systemischen Blicks.
Was passiert hier wirklich?
Welche unausgesprochenen Regeln halten dieses System stabil?
Welche Stimmen werden gehört – und welche nicht?
Schritt für Schritt erkannte sie Muster:
Ein über Jahre gewachsenes Bedürfnis nach Sicherheit.
Eine verdeckte Angst vor Kontrollverlust.
Und ein Management, das unbewusst Kommunikation mit Kontrolle verwechselte.
Sie begann, die Gespräche anders zu führen. Statt zwischen den Fronten zu stehen, stellte sie Fragen, die beide Seiten aus ihrer Starre holten:
„Was brauchen wir, um uns in dieser Unsicherheit sicher genug zu fühlen, weiterzugehen?“
„Woran würden wir erkennen, dass der Wandel wirklich begonnen hat?“
Innerhalb weniger Wochen verschob sich etwas.
Nicht spektakulär, aber spürbar.
Das System kam in Bewegung – nicht, weil jemand Druck machte, sondern weil jemand hinsah.
Coaching als Resonanzraum im Wandel
In solchen Situationen ist Coaching kein Luxus, sondern Notwendigkeit.
Es bietet den Raum, die eigene Position im Geflecht der Interessen, Erwartungen und Emotionen zu reflektieren – ohne selbst darin unterzugehen.
Als erfahrener Coach helfe ich,
- die eigenen inneren Konflikte zwischen Loyalität und Verantwortung zu sortieren,
- blinde Flecken in Kommunikation und Wahrnehmung zu erkennen,
- und den Handlungsspielraum neu zu definieren.
Im Coaching wird die Veränderung selbst zum Untersuchungsobjekt:
Welche Stimmen sprechen in mir, wenn ich Managemententscheidungen vertreten muss?
Welche Emotionen lösen die Reaktionen der Mitarbeitenden aus?
Und wo beginne ich, unbewusst Partei zu ergreifen, statt zu vermitteln?
Das Ziel ist nicht, neutral zu werden – sondern bewusst zu handeln.
Zwischen Management und Menschlichkeit
Echte Veränderung gelingt dann, wenn Menschen sie innerlich nachvollziehen können.
Wenn sie das „Warum“ verstehen und ihren eigenen Platz im neuen System finden.
Der systemische Blick erlaubt, mehrere Realitäten gleichzeitig zu sehen:
- Die Perspektive des Managements, das auf Effizienz und Zielerreichung fokussiert ist.
- Die Perspektive der Mitarbeitenden, die Sicherheit und Sinn suchen.
- Und die eigene Perspektive – als jemand, der zwischen diesen Welten vermittelt.
Coaching hilft, diese Spannungsfelder nicht als Belastung, sondern als Informationsquelle zu nutzen.
Denn Reibung ist nicht das Ende von Wandel – sie ist sein Anfang.
Der Nutzen für Organisationen
Organisationen, die ihre Change-Begleiter:innen professionell coachen lassen, investieren in die Qualität ihres Wandels.
Coaching stärkt:
- Resilienz: Wer die eigenen Grenzen kennt, bleibt handlungsfähig – auch unter Druck.
- Kommunikationskompetenz: Wer systemische Dynamiken versteht, erkennt Konflikte früh und kann sie konstruktiv gestalten.
- Führung im Wandel: Wer Ambivalenzen aushält, kann andere sicher durch Unsicherheit führen.
Das Ergebnis: weniger Reibungsverluste, mehr Vertrauen – und ein Wandel, der nicht nur auf Folien existiert, sondern im täglichen Miteinander spürbar wird.
Vom Ermittler zum Gestalter
Veränderung ist kein Zufall.
Sie ist das Ergebnis bewusster Beobachtung, kluger Entscheidungen, innerer Klarheit Verständnis und klarer Kommunikation.
Wer im Wandel ermittelt, erkennt Muster. – Wer sie versteht, gestaltet Zukunft.
Coaching ist dabei kein Werkzeug für „schwierige Fälle“, sondern ein professioneller Partner im Prozess – einer, der hilft, Komplexität zu entschlüsseln und Bewegung zu ermöglichen.
Denn echter Wandel beginnt dort,
wo Menschen sich selbst verstehen,
bevor sie andere verändern wollen.
Stehst du gerade in einem Veränderungsprozess und bist zwischen die Fronten geraten?
Sprich mich an oder schreibe mir in die Kommentare. Gemeinsam können wir herausfinden, ob ich dir helfen kann. Hier findest du meine Kontaktdaten.
Entdecke mehr von Stig Pfau
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.